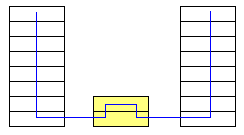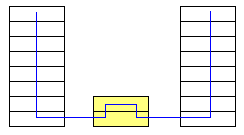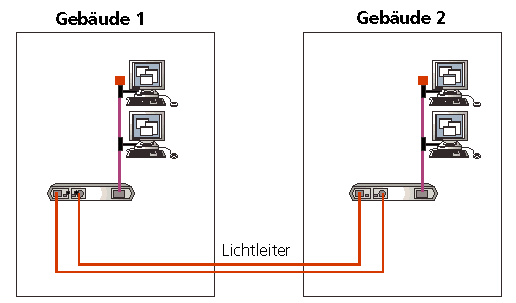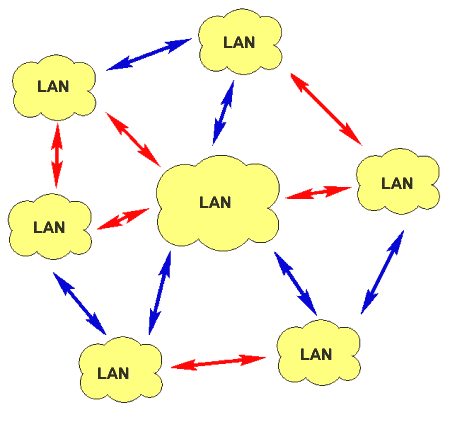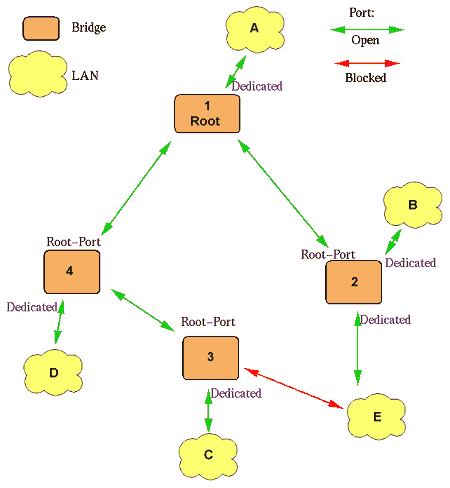Eine Bridge trennt zwei Ethernet-LANs physikalisch, Störungen wie z. B.
Kollisionen und fehlerhafte Pakete gelangen nicht über die Bridge hinaus. Die
Bridge ist protokolltransparent, d. h. sie überträgt alle auf dem Ethernet
laufenden Protokolle. Die beiden beteiligten Netze erscheinen also für eine
Station wie ein einziges Netz. Durch den Einsatz einer Bridge können die Längenbeschränkungen
des Ethernets überwunden werden. Die Bridge arbeitet mit derselben Übertragungsrate,
wie die beteiligten Netze. Die Anzahl der hintereinandergeschalteten Bridges ist
auf 7 begrenzt (IEEE 802.1). Normalerweise wird man aber nicht mehr als vier
Bridges hintereinanderschalten.
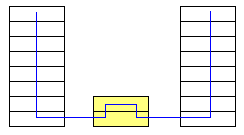
Jede lokale Bridge ist über Transceiver an zwei Ethernet-LANs angeschlossen
(Es gibt auch Bridges, die mehrere LANs verbinden können). Die Bridge erstellt
für jedes LAN eine Tabelle der Adressen aller Stationen, die Datenpakete
aussenden. Ist die Zieladresse eines Paketes in dem LAN, in dem es von der
Bridge empfangen wurde, wird es ignoriert. Ist es nicht darin, wird es in das
andere LAN gesendet. Es werden somit nur solche Pakete übertragen, die an die
jeweils andere Seite adressiert sind. Broadcasts und Multicasts werden immer übertragen.
Je nach Typ der Bridge können auch extra Filter gesetzt werden, um etwa den
Zugang mancher Stationen zu verhindern oder nur bestimmte Protokolle zuzulassen.
Eine Bridge arbeitet auf der Ebene 2 des OSI-Schichtenmodells.
Die Bridge empfängt von beiden Netzsegmenten, mit denen sie wie jede normale
Station verbunden ist, alle Blöcke und analysiert die Absender- und Empfängeradressen.
Steht die Absenderadresse nicht in der brückeninternen Adreßtabelle, so wird
sie vermerkt. Die Bridge lernt und speichert so die Information, auf welcher
Seite der Bridge der Rechner mit dieser Adresse angeschlossen ist. Ist die Empfängeradresse
bekannt und der Empfänger auf derselben Seite wie der Absender, so vewirft die
Bridge das Paket (filtert es). Ist der Empfänger auf der anderen Seite oder
nicht in der Tabelle, wird das Paket weitergeschickt. Die intelligente Bridge
lernt so selbständig, welche Pakete weitergeschickt werden müssen und welche
nicht. Bei managebaren Bridges können zusätzliche Adreß-Filter gesetzt
werden, die regeln an welche Adressen die Bridge Informationen immer
weiterschicken muß oder nie weiterschicken darf.
Bridges können Ethernet-Segmente auch über synchrone Standleitungen,
Satellitenverbindungen, Funkverbindungen, öffentliche Paketvermittlungsnetze
und schnelle Lichtleiternetze (z.B. FDDI) verbinden. In der Regel müssen solche
Bridges immer paarweise eingesetzt werden.
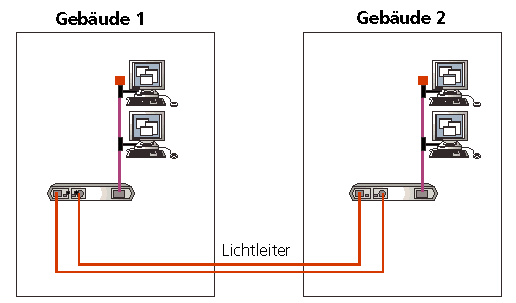
Bridges sind komplette, relativ leistungsfähige Rechner mit Speicher und
mindestens zwei Netzwerkanschlüssen. Sie sind unabhängig von höheren
Protokollen (funktionieren also z.B. mit TCP/IP, DECnet, IPX, LAT, MOP etc.
gleichzeitig) und erfordern bei normalem Einsatz keine zusätzliche Software
oder Programmierung. Nach Außen bildet ein mittels Bridge erweitertes LAN
weiterhin eine Einheit, welches eine eindeutige Adressierung bedingt. Eine
Bridge interpretiert die MAC-Adressen der Datenpackete. Weitere Features einer
Bridge sind:
- Ausfallsicherheit
Störungen gelangen von der einen Seite einer Bridge nicht auf die andere
Seite. Sie werden auch in diesem Sinne zum Trennen von sog.
Kollisions-Domainen eingesetzt.
- Datensicherheit
Informationen, die zwischen Knoten auf einer Seite der Bridge ausgetauscht
werden, können nicht auf der anderen Seite der Bridge abgehört werden.
- Durchsatzsteigerung
In den durch Bridges getrennten Netzsegmenten können jeweils
unterschiedliche Daten-Blöcke gleichzeitig transferiert werden. Hierdurch
wird die Netzperformance erhöht. Allerdings erzeugen Brücken dadurch, daß
sie die Blöcke zwischenspeichern eine zusätzliche Verzögerung und können
deswegen bei kaum ausgelasteten Netzen die Performance sogar verschlechtern.
- Vermeidung von Netzwerkschleifen
Eine Bridge unterstützt den sog. "Spanning-Tree-Algorithmus",
wodurch es möglich ist, auch Schleifen- oder Ring-Konfigurationen (=
redundante Verbindungen) im Netz zu erlauben. Die Bridges im Netz
kommunizieren miteinander, im Gegensatz zu "dummen" Repeatern oder
Hubs, und stellen über den Algorithmus sicher, daß bei mehreren
redundanten Verbindungen immer nur eine gerade aktiv ist.
Weitere Kenndaten einer Bridge sind die Größe der Adreßtabelle, die
Filterrate, und die Transferrate. Die Größe der Adreßtabelle gibt an,
wieviele Adressen (Knoten) insgesamt in der Bridge gespeichert werden können.
Die Filterrate gibt an, wieviele Pakete pro Sekunde (packets per second, pps)
eine Bridge maximal empfangen kann. Bei voller Last und minimaler Paketlänge können
in einem Ethernet-Segment theoretisch bis zu 14.880 Pakete pro Sekunde
auftreten. Auf beiden Ports hat eine 2-Port-Bridge also insgesamt maximal 29.760
Pakete pro Sekunde zu filtern. Alle modernen Bridges erreichen diese theoretisch
möglichen Maximalwerte. Die Transferrate gibt an, wieviel Pakete pro Sekunde
die Bridge auf die andere Seite weiterleiten kann. Der Maximalwert ist hier
14.880 pps, da bei dieser Transferrate beide Segmente voll ausgelastet sind.
Spanning Tree - Algorithmus
Der Algorithmus ist ebenfalls in IEEE 802.10 spezifiziert. Er wird eingesetzt um
bei Verknüpfungen von Netzwerken redundante Pfade (sog. Loops) durch einen
deterministischen logischen Pfad im Netz zu ersetzen. Im folgenden Beispiel sind
verschiedene LANs durch Bridges miteinander verknüpft, die im Bild durch Pfeile
repräsentiert werden.
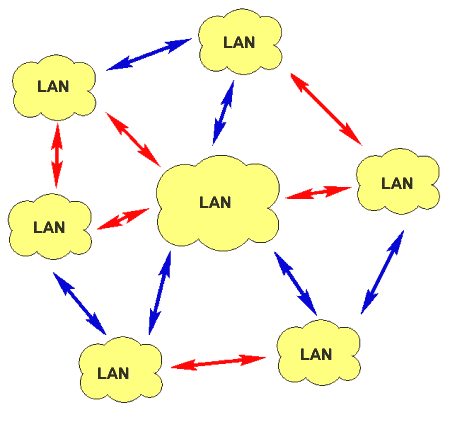
Alle Bridge-Links gemeinsam würden redundante Pfade im Netz ermöglichen,
was endlos kreisende Pakete zur Folge hätte. Mit dem "Spanning
Tree"-Algorithmus wird einer der möglichen logischen Pfade im Netz ausgewählt,
der keine Schleifen enthält. Das Ergebnis wird durch die blauen Pfeile
dargestellt die eine baumartige Struktur bilden. Im Extremfall kann hierdurch
eine Bridge sogar ganz aus dem Netzverkehr herausfallen.
Die Bridges kommunizieren untereinander mit Hilfe der sog. Bridge Protocol
Data Units (BPDU). Jede Bridge benötigt eine gewisse Grundkonfiguration, um
den Algorithmus einsetzen zu können:
- Bridge: Eindeutige Bridge-ID.
- Port: Eindeutige Port-ID.
- Port: Relative Port-Priorität.
- Port: "Kostenfaktor" für jeden Port (je höher die
Netzwerk-Performance im angeschlossenen LAN, desto geringer die Kosten).
In Abhängigkeit dieser Parameter wird der logische Baum folgendermaßen
automatisch von allen Bridges zusammen aufgespannt:
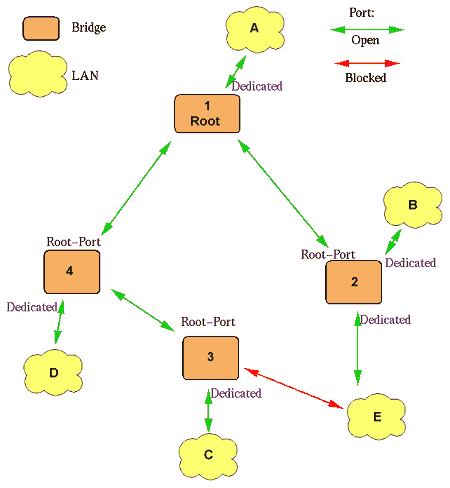
- Auswahl der Root-Bridge
Die Root-Bridge ist die Bridge mit der kleinsten Bridge-ID. Haben zwei
Bridges dieselbe ID, so wird diejenige mit der kleinsten MAC-Adresse ausgewählt.
- Auswahl eines Root-Ports pro Bridge
Mit Außnahme der Root-Bridge, wird bei jeder Bridge einer der Ports als
Root-Port festgelegt. Dieser Port wird mit Hilfe der geringsten
"Wegkosten" zur Root-Bridge ermittelt.
- Zuordnung einer Bridge pro LAN
Diese Zuordnung ist entscheident, da sonst Schleifen entstehen.
- Im Falle daß nur eine Bridge an ein bestimmtes LAN angebunden ist,
ist die Wahl einfach: jener Port, welcher zu diesem LAN gehöhrt, wird
ihm auch global zugeordnet.
- Haben mehrere Bridges einen direkten Zugang zu einem LAN, wird
diejenige ausgewählt, welche betreffend der Wegkosten zur Root-Bridge
am günstigsten ist.
mit freundlicher Unterstüztung von Herrn Prof. Jürgen Plate